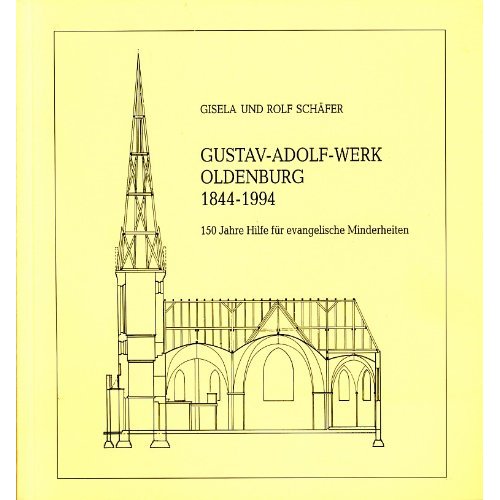Oberkirchenrat i. R. Prof. Dr. Rolf Schäfer berichtet:
175 Jahre Gustav-Adolf-Werk in Oldenburg
1. Wie alles anfing
1844 versammelten sich 20 Männer – Verwaltungsbeamte, Theologen, Pädagogen, Kaufleute und Handwerksmeister – im Oldenburger Rathaus, um einen Verein zur Hilfe für unterdrückte evangelische Minderheiten in und außerhalb Deutschlands zu gründen.
Die Gründung fand großen Wiederhall. Rings um den Verein in der Hauptstadt des damaligen Großherzogtums Oldenburg entstanden in den städtischen und ländlichen Kirchengemeinden weitere Vereine, die bereit waren, Zeit und Geld für evangelische Minderheiten aufzubringen.
Heute würde man solche Aufgaben der EKD (Evang. Kirche in Deutschland) zuweisen. Aber damals gab es noch keine EKD. Nach dem Wiener Kongress 1815 bestand Deutschland aus 35 selbständigen Fürstentümern und 4 freien Städten, die sich zum Deutschen Bund zusammengeschlossen hatten. In den meisten dieser 39 Staaten gab es evangelische Kirchen. Diese hatten jedoch als jeweilige Staatskirchen keine Möglichkeit, mit anderen deutschen Staatskirchen Verbindungen zu knüpfen oder gemeinsame Hilfsmaßnahmen zu ergreifen.
Gleichzeitig gab es aber das starke Bedürfnis, sich über die Staatsgrenzen hinweg mit den Nachbarn zu verständigen. Bekannt ist das bürgerliche Einheitsstreben, das zum engeren Zusammenschluss der Bundesstaaten kommen wollte und das 1848 in der Frankfurter Nationalversammlung zum Ausdruck kam. Parallel dazu war aber auch in den lutherischen, unierten und reformierten Landeskirchen ein Einheitsbewusstsein gewachsen, das sich in der konsistorialen Kleinstaaterei nicht mehr zu Hause fühlte, sondern auf die evangelischen Kirchen in ganz Deutschland, ja über Deutschland hinausblickte.
In dieses Einheitsbewusstsein wurden auch die evangelischen Minderheiten einbezogen, die in Süddeutschland und in anderen europäischen Ländern die Gegenreformation überstanden hatten und für deren prekäre Lage sich der Begriff Diaspora (Zerstreuung) anbot.
Für diese Bestrebungen dieser Art gab es in der Zeit des Deutschen Bundes weder staatliche noch kirchliche Unterstützung. Es stand damals nur das private Stiftungs- und Vereinsrecht zur Verfügung. 1832 wurde in Leipzig die Gustav-Adolf-Stiftung gegründet, die 1843 in einer deutschlandweiten Hauptversammlung in der Frankfurter Paulskirche ihre Ziele und ihren Namen präsentierte.
2. Warum Gustav Adolf?
Der Name des schwedischen Königs Gustav II. Adolf Wasa (1594-1632) war im 19. Jahrhundert ebenso bekannt wie der Name Martin Luthers – dies wird auch durch den damals häufig vorkommenden Vornamen Gustav belegt. Jedermann wusste, dass König Gustav Adolf im Dreißigjährigen Krieg den Protestantismus vor dem Untergang gerettet hatte. Denn im Jahre 1629 standen die siegreichen Heere des Kaisers Ferdinand II. an Nord- und Ostsee. Dadurch wäre das ganze evangelische Norddeutschland rekatholisiert worden, hätte nicht der Schwedenkönig in den Krieg eingegriffen. Zwar wurde Gustav Adolf 1632 in der Schlacht bei Lützen getötet. Die Beteiligung Schwedens am Kriegsgeschehen hatte jedoch zur Folge, dass der Protestantismus in Deutschland überlebte und im Westfälischen Frieden 1648 auch rechtlich anerkannt wurde.
Dies blieb im evangelischen Deutschland des 19. Jahrhunderts unvergessen. Als nun nach dem Wiener Kongress (1815) in den Habsburgischen Ländern die reaktionäre Politik erneut anfing, die dort übriggebliebenen evangelischen Minderheiten zu schikanieren, lag es für die deutschen Protestanten nahe, ihre Solidarität mit diesen gefährdeten Gemeinden in dankbarer Erinnerung an ihre eigene Rettung unter den Namen Gustav Adolf zu stellen. Dabei verstand es sich von selbst, dass alle Gegengewalt ausgeschlossen war und es nicht darum ging, die katholische Kirche zu bekämpfen oder Proselyten zu gewinnen, sondern darum, wie es damals hieß: bestehende evangelische Kirchen und Gemeinden vor Verkümmerung zu bewahren.
Diese Gefahr der Verkümmerung bestand und besteht auch heute noch besonders dort, wo evangelische Christen in kleiner Zahl sich selbst überlassen bleiben und – wie es früher üblich war - von der Mehrheitskonfession bedrängt werden.
3. Der oldenburgische Gustav-Adolf-Verein im 19. Jahrhundert.
Bald musste die evangelische Kirche in Oldenburg lernen, dass nicht nur in den habsburgischen Ländern, sondern unmittelbar im eigenen Land Hilfe für verstreute evangelische Christen nötig ist: im Oldenburger Münsterland. Dieses war bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges flächendeckend evangelisch gewesen, dann aber bis auf wenige Reste von den bayerischen Erzbischöfen von Köln und Münster durch staatlichen Zwang rekatholisiert worden. Als 1803 die Münsterschen Ämter Vechta und Cloppenburg an Oldenburg fielen, wurde zwar für die evangelischen Beamten, die nun in Vechta und Cloppenburg tätig wurden, eine notdürftige kirchliche Betreuung eingerichtet. Aber für die seit alters ansässigen evangelischen Familien in Wulfenau und Fladderlohausen oder für die unerfreuliche gottesdienstliche Lage in Goldenstedt fühlte sich das oldenburgische Konsistorium zunächst nicht zuständig.
Dies wurde erst anders, als der Gustav-Adolf-Verein die erste Sammlung, die er veranstaltete, der evangelischen Gemeinde Goldenstedt für ihren Kirchbau zuwandte. Langsam wuchs nun das Bewusstsein der evangelischen Nordoldenburger für ihre südoldenburgische Diaspora. Überall, wo im Laufe des 19. Jahrhunderts in diesem Gebiet evangelische Kirchen, Schulen, Gemeindehäuser und Pfarrhäuser entstanden sind, war es der Gustav-Adolf-Verein, der für Information, für Zuschüsse und oft auch für den nötigen Nachdruck der Kirchenleitung sorgte.
Kirchen und Kapellen wurden zunächst für die evangelische Diaspora in mehrheitlich katholischen Städten und Dörfern gefördert (Cloppenburg, Friesoythe, Damme, Essen, Löningen, Lohne), sondern bald auch in den neu entstehenden gemischt-konfessionellen Moorkolonien: Elisabethfehn, Sedelsberg, Reekenfeld oder Idafehn.
Die Aufgaben erweiterten sich, als 1856 der Gustav-Adolf-Frauenverein gegründet wurde. Er kümmerte sich nicht nur um die Ausstattung des oft sehr dürftigen Inneren der Diasporakirchen, sondern versuchte die Not der evangelischen Familien besonders in den Moorkolonien zu lindern.
Alle diese kirchlichen und diakonischen Hilfen standen dabei im Rahmen eines wachsenden Gemeinschaftsbewusstseins, das sich nicht auf Oldenburg beschränkte. Dieses kommt beispielhaft im 1. Artikel des 1849 formulierten oldenburgischen Kirchenverfassungs-Gesetzes zum Ausdruck, bei dem führende Mitglieder des Gustav-Adolf-Vereins mitgewirkt hatten. Danach fühlt sich die evangelische Kirche in Oldenburg damals schon als ein Glied der evangelischen Kirche Deutschlands, ja sogar der gesamten evangelischen Kirche.
Eine solche Ortsbestimmung der evangelischen Kirchengemeinden war damals mehr als ungewöhnlich. Sie erweiterte den sprichwörtlichen Kirchturmhorizont auf ganz Deutschland und trug schließlich im 20. Jahrhundert zur Bildung einer Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) bei. Diese ist inzwischen als gemeinsame Kirche anerkannt, in der alle deutschen evangelischen Landeskirchen zusammengeschlossen sind. Noch nicht so weit entwickelt ist das Gemeinschaftsbewusstsein im Blick auf die oft kleinen und bescheidenen evangelischen Gemeinden im Ausland, die 1849 schon unter dem Begriff der gesamten evangelischen Kirche in die oldenburgische Kirchenordnung eingegangen war.
4. Das oldenburgische Gustav-Adolf-Werk im 20. Jahrhundert
Die Turbulenzen der Politik erfassten nach dem Ersten Weltkrieg nicht nur die evangelische Kirche, sondern auch die Diaspora-Arbeit. Das Ende der Monarchie, die wirtschaftliche Not, die ungewohnte Freiheit der Zwanzigerjahre und ihre Abschaffung in den Dreißigerjahren beschränkten alle kirchliche Arbeit auf das Nächstliegende, wozu die Diaspora-Arbeit vorläufig nicht gehörte. Und als nach dem Zweiten Weltkrieg eine gewisse Erholung eintrat, konnte man nicht einfach am Früheren anknüpfen. Dies hatte vor allem zwei Gründe.
Erstens, beim Wiederaufbau der evangelischen Landeskirchen griff man zwar überall auf Elemente der Tradition zurück, misstraute jedoch der aus dem 19. Jahrhundert stammenden Rechtsform des bürgerlichen Vereins. Auch Diaspora-Arbeit sollte Sache der Kirche sein – also nicht mehr Gustav-Adolf-Verein, sondern nunmehr Gustav-Adolf-Werk. Freilich stützt sich die Hauptgruppe Oldenburg nach wie vor als eingetragener Verein auf ihre Mitglieder, die sich im Ehrenamt der Diaspora-Hilfe verpflichtet fühlen. In diesen neu organisierten Verein wurde auch der 1856 entstandene Gustav-Adolf-Frauenverein integriert.
Zweitens, die deutsche Teilung führte auch zu einer Teilung des Gustav-Adolf-Werks. In Leipzig wurde die Arbeit für die evangelischen Kirchen in der DDR fortgeführt, soweit die engen staatlichen Vorgaben es zuließen. Für die Kirchen in der Bundesrepublik entstand in Kassel eine zweite Zentrale, in der sich die Diasporahilfe der westdeutschen evangelischen Kirchen unter dem Namen Gustav-Adolf-Werk neu konstituierte. Natürlich wurde dabei die Frage aufgeworfen, ob der Name des Schwedenkönigs noch zeit- und sachgemäß sei. Die Verbindungen zu den evangelischen Diasporakirchen in Süd- und Osteuropa sowie in Südamerika waren jedoch dort so fest mit der Markenbezeichnung Gustav-Adolf-Werk verbunden, dass man auf diese nicht verzichten konnte.
Nach dem Mauerfall 1989 war auch für die beiden Zentralen in Leipzig und Kassel der Augenblick der Wiedervereinigung gekommen. Sie vollzogen diese, indem die beiden Werke 1990 unter einer neuen Satzung in einem gemeinsamen Gustav-Adolf-Werk der EKD aufgingen, das seinen Sitz wieder in Leipzig einnahm. Bei dieser schwierigen Fusion konnte die oldenburgische Hauptgruppe durch einen Sitz im Gesamtvorstand tatkräftig mitwirken. Von 2002 bis 2008 nahm Oldenburg durch Frau Gisela Schäfer die Aufgaben einer stellvertretenden Präsidentin im Gesamtwerk wahr.
5. Wie arbeitet das oldenburgische Gustav-Adolf-Werk in der Praxis?
Jedes Jahr erarbeitet die zentrale Dienststelle des Gustav-Adolf-Werks der EKD in Leipzig einen Katalog der Vorhaben, die nach Kenntnis und Beurteilung der zuständigen Gremien förderungswürdig sind. So enthält der GAW-Projektkatalog 2019 auf 289 Seiten nicht weniger als 130 Projekte, die in Europa und Südamerika geplant werden. Sie sind nach den Partnerkirchen in den jeweiligen Ländern geordnet.
Eines dieser Projekte wurde von der Griechisch-Evangelischen Kirche beantragt, die in Serres (Makedonien) nahe der bulgarischen Grenze ihre Kirche und ihre Gemeinderäume sanieren muss. Im Projektkatalog wurden diese Maßnahmen beschrieben. Der zuständige Pfarrer Meletis Meletiadis wurde zum oldenburgischen Gustav-Adolf-Fest am Sonntag Rogate (21. Mai 2017) nach Rastede eingeladen. Dort hielt er im Gottesdienst die Predigt und berichtete am Nachmittag anschaulich von seiner Gemeinde und ihren Sorgen und Plänen. Weil sich die Gemeinde selbst an ihre Vertreibung aus der Türkei nach dem griechisch-türkischen Krieg (1919-1922) erinnerte, organisierte sie von 2015 an Hilfsaktionen für das nahegelegene Flüchtlingslager Idomeni.
Für die in Serres veranschlagten Gesamtkosten von € 54.000 schreibt die Leipziger Zentrale eine Förderung in Höhe von € 18.000 aus. Die Hauptgruppe Oldenburg beteiligte sich daran, indem sie € 10.000 nach Leipzig überwies.
Dieses Beispiel veranschaulicht, nach welchen Grundsätzen das Gustav-Adolf-Werk in seiner Diasporahilfe verfährt. Unterstützt werden Maßnahmen, die dem Gottesdienst, der kirchlichen Arbeit und der theologischen Bildung zugutekommen. Es wird dabei vorausgesetzt, dass die jeweilige Kirchengemeinde sich nach Kräften selbst bemüht und dass die zuständige Kirchenleitung das Vorhaben geprüft und genehmigt hat. Wünschenswert ist es, dass es dabei auch zu persönlichen Begegnungen zwischen Oldenburg und den Diasporagemeinden kommt. Dies ist freilich bei großen Entfernungen nur schwer möglich. Einen Ersatz bilden die von Leipzig bereitgestellten Informationen und Bilder, die es den hiesigen Vertreter des Gustav-Adolf-Werks ermöglicht, die Projekte in Vorträgen vorzustellen.
Ihre Einnahmen erzielt die oldenburgische Hauptgruppe durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Nachlässe und durch die Kollekte am Sonntag Rogate in allen oldenburgischen Kirchen. Zählt man alles zusammen, was die Hauptgruppe Oldenburg in den letzten 25 Jahren als Zuschüsse an die Partnergemeinden gegeben hat, dann ergeben sich rund € 660.000, die den sorgfältig ausgewählten Projekten in Osteuropa, Südost- und Südeuropa, Frankreich sowie Südamerika zugutekamen.
Die Gustav-Adolf-Frauenarbeit hat sich zwar nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr als separater Verein konstituiert, kann aber im Blick auf ihre Zusammenkünfte und Informationsveranstaltungen noch an ältere Traditionen anknüpfen. Auf diesem Weg sind im gleichen Zeitraum € 754.000 an Zuwendungen für Partner gesammelt und vergeben worden.
Es wäre aber verkehrt, in den insgesamt 1,4 Millionen € nur den Geldwert sehen zu wollen. Denn sie setzen sich aus vielen kleinen Beträgen zusammen, die in Kenntnis der schwierigen Umstände der Empfänger als bewusste Hilfe zur Selbsthilfe gespendet worden sind.
6. Ist konfessionelle Diasporahilfe nicht veraltet?
Nicht selten ist das Argument zu hören: Wir leben doch im Zeitalter der Ökumene! Warum schließen sich die evangelischen Minderheiten nicht der römisch-katholischen oder der orthodoxen Mehrheit an?
Ökumene bedeutet nicht Unterwerfung. Dass in Oldenburg dank des lebendigen ökumenischen Gesprächs zwischen evangelischen und katholischen Gemeinden und Kirchenleitungen ein angenehmes Klima herrscht, beruht u. a. darauf, dass sie auf Augenhöhe und in gegenseitiger Achtung miteinander reden. Dies ist nicht in allen Ländern der Fall. Trotz der freundlichen Gesten von Papst Franziskus und trotz des friedfertigen gemeinsamen Reformationsgedächtnisses 2017 wirkt in vielen mehrheitlich römisch-katholischen Ländern die Verdammung Luthers und aller seiner Anhänger immer noch nach und vergiftet die Atmosphäre. Und wo die Orthodoxie staatliche Bevorzugung genießt, haben evangelische Minderheitskirchen einen schweren Stand.
Gerade um der Ökumene willen sollten wir, die wir unter solchen Schwierigkeiten nicht leiden, die evangelische Diaspora nicht im Stich lassen. Das Gustav-Adolf-Werk hilft deshalb denn zerstreuten Gemeinden, selbstbewusst den evangelischen Glauben zu leben und auf dem Boden dieses Glaubens das Gespräch mit den anderen Konfessionen zu suchen. Deshalb sind gottesdienstliche Räume und Gemeindehäuser wichtig, in denen sich die Evangelischen versammeln, Trost aus dem Evangelium und Kraft für ihren Alltag schöpfen können. Und für Gottesdienst und Seelsorge sind gut ausgebildete Pastoren und Pastorinnen wichtig, die der Diasporasituation gewachsen sind.
Zur Bewältigung dieser Aufgaben trägt das Gustav-Adolf-Werk bei und genießt dafür in der außerdeutschen evangelischen Diaspora hohes Ansehen.
Literatur: Gisela und Rolf Schäfer, Gustav-Adolf-Werk Oldenburg 1844-1994, Oldenburg 1994. – Rolf Schäfer, Oldenburgische Kirchengeschichte, 2. Auflage, Oldenburg 2005.